„Wir können doch nicht für jedes Kind eine Extrawurst braten!“
Das sagte erst letzte Woche wieder eine Kita-Leitung in einer Fortbildung zu mir. Und ich dachte: Doch. Genau das können wir. Und genau das müssen wir.
Aber sie meinte es anders: „Wir müssen alle Kinder gleich behandeln. Das ist nur gerecht.“
Und da ist es passiert: Ich bin innerlich explodiert.
Denn Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit.
Und diese Verwechslung, die ich immer wieder höre, in Kitas, in Grundschulen, in meinen Weiterbildungen, macht mich ehrlich gesagt wütend.
Warum? Weil sie gerade den Kindern schadet, die ohnehin schon am meisten kämpfen müssen. Weil sie Inklusion verhindert. Weil sie aus herausforderndem Verhalten Krisenverhalten macht. Und weil sie zeigt, dass wir ein grundlegendes Missverständnis darüber haben, was Kinder wirklich brauchen.
Das Märchen von der Gleichbehandlung
„Alle bekommen das Gleiche“ – das klingt fair, oder?
Alle Kinder bekommen 15 Minuten Zeit für die Aufgabe.
Alle Kinder müssen still am Tisch sitzen.
Alle Kinder bekommen die gleiche Unterstützung.
Klingt nach Gerechtigkeit. Ist es aber nicht.
Stell dir vor, ich gebe allen Kindern in der Gruppe die gleichen Schuhe in Größe 32.
Dem Vierjährigen sind sie zu groß. Der Siebenjährigen zu klein. Nur zwei von zehn Kindern passen sie tatsächlich.
Ist das gerecht? Natürlich nicht. Es ist absurd.
Aber genau das tun wir täglich in unseren Einrichtungen.
Wir behandeln alle gleich und nennen es Gerechtigkeit. Dabei ignorieren wir völlig, dass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Bedürfnissen und Herausforderungen zu uns kommen.
Dieses Video zeigt den Unterschied, Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenGleichheit bedeutet: Alle bekommen das Gleiche (drei Kisten gleicher Höhe).
Gerechtigkeit bedeutet: Jeder bekommt, was er braucht (unterschiedlich hohe Kisten, damit alle über die Mauer schauen können).
Wenn Inklusion an der Gleichheits-Illusion scheitert
Weißt du, was mich am meisten aufregt?
Dass wir von Inklusion reden und dann genau das Gegenteil tun.
Die UN-Behindertenrechtskonvention sagt klar: Menschen werden nicht durch ihre Beeinträchtigungen behindert, sondern durch gesellschaftliche Barrieren.
Übertragen auf die Kita bedeutet das: Nicht das Kind muss sich ändern, sondern das System.
Aber was passiert stattdessen?
Ein Kind mit ADHS, das motorisch unruhig ist, soll genauso lange stillsitzen wie alle anderen „weil wir keine Extrawurst braten können.“
Ein traumatisiertes Kind, das Nähe braucht, bekommt die gleiche standardisierte „professionelle Distanz“ wie alle anderen „damit sich keiner benachteiligt fühlt.“
Ein autistisches Kind, das Struktur und Vorhersehbarkeit braucht, wird in spontane Situationen gedrängt „die anderen müssen sich ja auch anpassen.“
Das ist nicht Inklusion. Das ist Ausgrenzung im Gewand der Gleichheit.
Und das Perfide daran? Wir rechtfertigen es mit Fairness. Wir sagen: „Wenn wir für Max eine Ausnahme machen, fühlen sich die anderen benachteiligt.“
Nein. Das ist nicht Gerechtigkeit. Das ist Gleichmacherei.
Wenn Gleichbehandlung herausforderndes Verhalten eskalieren lässt
Ich erlebe das immer wieder: Ein Kind zeigt herausforderndes Verhalten und wir reagieren darauf, indem wir es noch mehr in die Norm pressen wollen.
Ein Beispiel:
Max schlägt andere Kinder. Immer wieder. Es fordert dich als Fachkraft heraus. Du weißt nicht mehr weiter.
Deine Reaktion (aus dem Gleichheits-Denken heraus):
„Max muss lernen, sich an die Regeln zu halten wie alle anderen auch. Wenn er schlägt, gibt es eine Konsequenz. Punkt.“
Du setzt Grenzen. Du bist konsequent. Du behandelst Max gleich wie alle anderen.
Und natürlich müssen wir eingreifen, wenn Max schlägt. Natürlich müssen wir die anderen Kinder schützen. Natürlich setzen wir Grenzen.
Aber die entscheidende Frage ist eine andere:
Fragen wir: „Was ist falsch mit Max?“
Oder fragen wir: „Was braucht Max, um nicht schlagen zu müssen?“
Das Problem mit der ersten Frage:
Wenn wir nur fragen „Was ist falsch mit Max?“, suchen wir das Problem im Kind. Und unsere Lösung ist: Max muss sich ändern. Max muss lernen. Max muss sich anpassen, wie alle anderen auch.
Max schlägt aber nicht, weil er die Regeln nicht kennt. Max schlägt, weil er überfordert ist. Weil die Gruppe zu laut ist. Weil er nicht weiß, wie er sich anders regulieren soll. Weil er nicht versteht, was von ihm erwartet wird.
Was passiert, wenn wir ihn gleich behandeln wie alle anderen?
Er wird noch mehr überfordert. Die Überforderung steigt. Aus herausforderndem Verhalten wird Krisenverhalten. Max ist nicht mehr ansprechbar. Er ist im Überlebensmodus: Kampf, Flucht oder Erstarren.
Und jetzt? Jetzt hast du eine Krise. Jetzt musst du sichern, deeskalieren, co-regulieren.
Alles, weil wir an der Gleichheits-Illusion festgehalten haben statt zu fragen: „Was braucht Max, um nicht schlagen zu müssen?“
Der Unterschied, der vieles verändert: Gerechtigkeit statt Gleichheit in der Kita
Gerechtigkeit bedeutet nicht, allen das Gleiche zu geben.
Gerechtigkeit bedeutet, jedem das zu geben, was er oder sie braucht, um teilhaben zu können.
Das ist nicht kompliziert. Das ist eigentlich logisch. Aber es erfordert einen Perspektivwechsel:
Weg von: „Was bekommt Max mehr als die anderen?“
Hin zu: „Auf welche Barrieren trifft Max und wie können wir sie abbauen?“
Konkrete Beispiele:
Dem Kind, das nicht stillsitzen kann, gebe ich einen Bewegungsauftrag oder einen Sitzball.
→ Ich baue die Barriere „stillsitzen müssen“ ab.
Dem Kind, das Struktur braucht, gebe ich visuelle Unterstützung (Bilder, Abläufe, klare Ansagen).
→ Ich baue die Barriere „unvorhersehbare Situationen“ ab.
Dem Kind, das reizüberflutet ist, gebe ich einen Rückzugsort oder Kopfhörer mit Noise-Cancelling.
→ Ich baue die Barriere „zu viele Reize“ ab.
Ist das ungerecht den anderen gegenüber?
Nein. Weil jedes Kind bekommt, was es braucht, um teilhaben zu können.
Die anderen Kinder verstehen das übrigens viel besser als wir denken. Wenn wir es erklären. Wenn wir Bedürfnisorientierung vorleben statt Gleichmacherei.
Erinnerst du dich an das Video von oben? Genau so erkläre ich es den Kindern.
Warum diese Verwechslung so gefährlich ist – besonders für Kinder mit herausforderndem Verhalten
Diese Gleichheits-Illusion hat konkrete Folgen und sie trifft die Kinder am härtesten, die ohnehin schon am meisten kämpfen:
1. Wir übersehen individuelle Bedürfnisse
Wenn alle gleich behandelt werden müssen, können wir nicht auf das einzelne Kind eingehen. Wir ignorieren, was einzelne Kinder brauchen, weil wir „fair“ sein wollen.
2. Wir verstärken Ungerechtigkeiten
Kinder, die ohnehin schon ein schweres Päckchen tragen, bekommen nicht das, was sie bräuchten, um teilhaben zu können.
3. Aus herausforderndem Verhalten wird Krisenverhalten
Wenn ein Kind dauerhaft überfordert ist, weil wir es „gleich behandeln“ statt seine Bedürfnisse zu sehen, eskaliert das Verhalten.
Und dann?
Dann kannst du nicht mehr professionell handeln. Dann geht es nur noch um Sicherheit und Co-Regulation. Dann bist du im Feuerwehrmodus und alle sind am Limit.
4. Wir brennen aus
Fachkräfte, die sich zwischen „alle gleich behandeln“ und „individuell fördern“ zerrissen fühlen, verzweifeln. Weil beides gleichzeitig nicht geht. Und weil sie täglich erleben, wie Kinder auf der Strecke bleiben.
5. Inklusion wird unmöglich
Inklusion bedeutet: Alle Kinder sind willkommen. Mit allen ihren individuellen Bedürfnissen. Wenn wir aber alle gleich behandeln wollen, schließen wir genau die Kinder aus, die am meisten Unterstützung bräuchten.
Was wir stattdessen brauchen: Von der Gleichheit zur Gerechtigkeit
Einen Perspektivwechsel.
Weg von: „Was bekommen alle?“
Hin zu: „Was braucht dieses Kind?“
Das ist unbequem und kostet zunächst Energie. Aber genau das ist professionelle Haltung: Den Mut haben, Unterschiede anzuerkennen und danach zu handeln.
Und zwar nicht nur, weil der Alltag entspannter wird.
Sondern weil Kinder etwas fürs Leben lernen:
- Bedürfnisse sind okay
- Unterschiede sind normal
- Jeder bekommt, was er braucht, nicht, was alle bekommen
- Barrieren können abgebaut werden
- Wir gehören alle dazu
Das ist die Grundlage für eine Gesellschaft, die niemanden zurücklässt.
Was du konkret tun kannst (ohne dich zu verbiegen)
Ich weiß: Das klingt alles schön und gut. Aber wie setzt man das um? Gerade wenn das Team oder die Eltern sagen: „Das ist aber unfair!“?
Der erste Schritt: Beschäftige dich mit den Ursachen und Funktionen von herausforderndem Verhalten
Wenn du anfängst zu verstehen, warum ein Kind sich so verhält und welche Funktion das Verhalten hat (Kommunikation? Überforderung? Reizüberflutung? exekutive Dysfunktion?), wird dir eine Sache glasklar:
Es KANN nicht das Gleiche für alle geben.
Weil Kinder unterschiedliche Ursachen haben. Unterschiedliche Bedürfnisse. Unterschiedliche Barrieren.
Und dann wird aus „Wir müssen alle gleich behandeln“ plötzlich eine absurde Idee.
Drei konkrete Schritte, die dir helfen
1. Verstehe den Unterschied zwischen herausforderndem Verhalten und Krisenverhalten
Warum ist das wichtig?
Weil du bei herausforderndem Verhalten präventiv arbeiten kannst: Barrieren abbauen, Strukturen schaffen, Bedürfnisse erfüllen. Bei Krisenverhalten kannst du nur noch reagieren und sichern.
2. Schaue systematisch auf Barrieren statt auf das Kind
Statt zu fragen: „Was stimmt mit dem Kind nicht?“
Frage: „Welche Barrieren gibt es? Was zeigt uns das Kind? Was können wir im System verändern?“
Oft stellen wir fest: Wenn wir im System etwas verändern (mehr Struktur, weniger Lärm, klarere Übergänge, visuelle Unterstützung), verändert sich auch das Verhalten des Kindes.
Nicht immer. Aber oft.
Und selbst wenn das Verhalten bleibt: Wir haben die Rahmenbedingungen verbessert und davon profitieren alle Kinder.
3. Erkläre Gerechtigkeit statt Gleichheit auch den Kindern
Kinder verstehen den Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit besser, als wir denken.
Erinnerst du dich an das Video von oben? Genau so erkläre ich es den Kindern. Ich male es ihnen auf. Drei Kinder an einer Mauer. Alle bekommen eine Kiste aber nur das große Kind kann drüberschauen. Ist das gerecht?
Dann male ich es anders: Jedes Kind bekommt die Kiste, die es braucht. Jetzt können alle drei drüberschauen. Das ist gerecht.
Die Kinder verstehen sofort: „Ach so! Jeder bekommt, was er braucht!“
Den Eltern kannst du sagen: „Wir behandeln alle Kinder gerecht das bedeutet nicht gleich, sondern bedürfnisorientiert. Jedes Kind bekommt, was es braucht, um teilhaben zu können.“
Im Team: „Inklusion bedeutet: Wir bauen Barrieren ab statt Kinder auszuschließen. Das ist anstrengend aber es ist das, wofür wir stehen. Inklusion ist ein Menschenrecht und somit unverhandelbar.“
Gerechtigkeit beginnt auch bei dir
Wir können Kinder nur gerecht begleiten, wenn wir auch mit uns selbst gerecht sind.
Das heißt:
- Ich darf Pausen brauchen.
- Ich darf überfordert sein.
- Ich darf Unterstützung einfordern.
Gerechtigkeit in der Pädagogik beginnt nicht (nur) beim Kind, sie beginnt bei den Erwachsenen, die bereit sind, sich selbst als Teil des Systems zu sehen. Wenn du dir erlaubst, dich selbst gerecht zu behandeln, kannst du auch den Kindern gerechter begegnen.
Oder, wie ich gerne in Fortbildungen sage: „Selbstfürsorge ist Grundlage professioneller Beziehungsgestaltung.“
Denn wer ständig über seine Grenzen geht, kann langfristig keine Grenzen halten.
Und wer nie bekommt, was er braucht, wird irgendwann aufhören, zu sehen, was andere brauchen.
Schluss mit der Gleichmacherei – für eine echte inklusive Pädagogik
„Wir müssen alle gleich behandeln“ ist nicht dasselbe wie „Wir müssen alle gerecht behandeln.“
Und es wird Zeit, dass wir das endlich verstehen: nicht nur theoretisch, sondern praktisch.
Alle Kinder brauchen das. Und wir pädagogischen Fachkräfte auch.
Übrigens: Beim Dienstplan freuen wir uns doch ebenfalls, wenn individuelle Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Oder wenn ich als Fachkraft ohne eigene Kinder auch außerhalb der Schulferien Urlaub nehmen kann.
Wir brauchen ein System, in dem wir nicht zwischen gerecht und gleich wählen müssen.
Inklusion heißt: Alle gehören dazu. Bedingungslos.
Nicht: „Alle müssen sich anpassen.“
Sondern: „Wir schaffen ein System, in dem alle sein können, wie sie sind.“
Das ist der Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit.
Und genau dafür lohnt es sich, wütend zu sein.
Und genau dafür lohnt es sich, zu kämpfen.

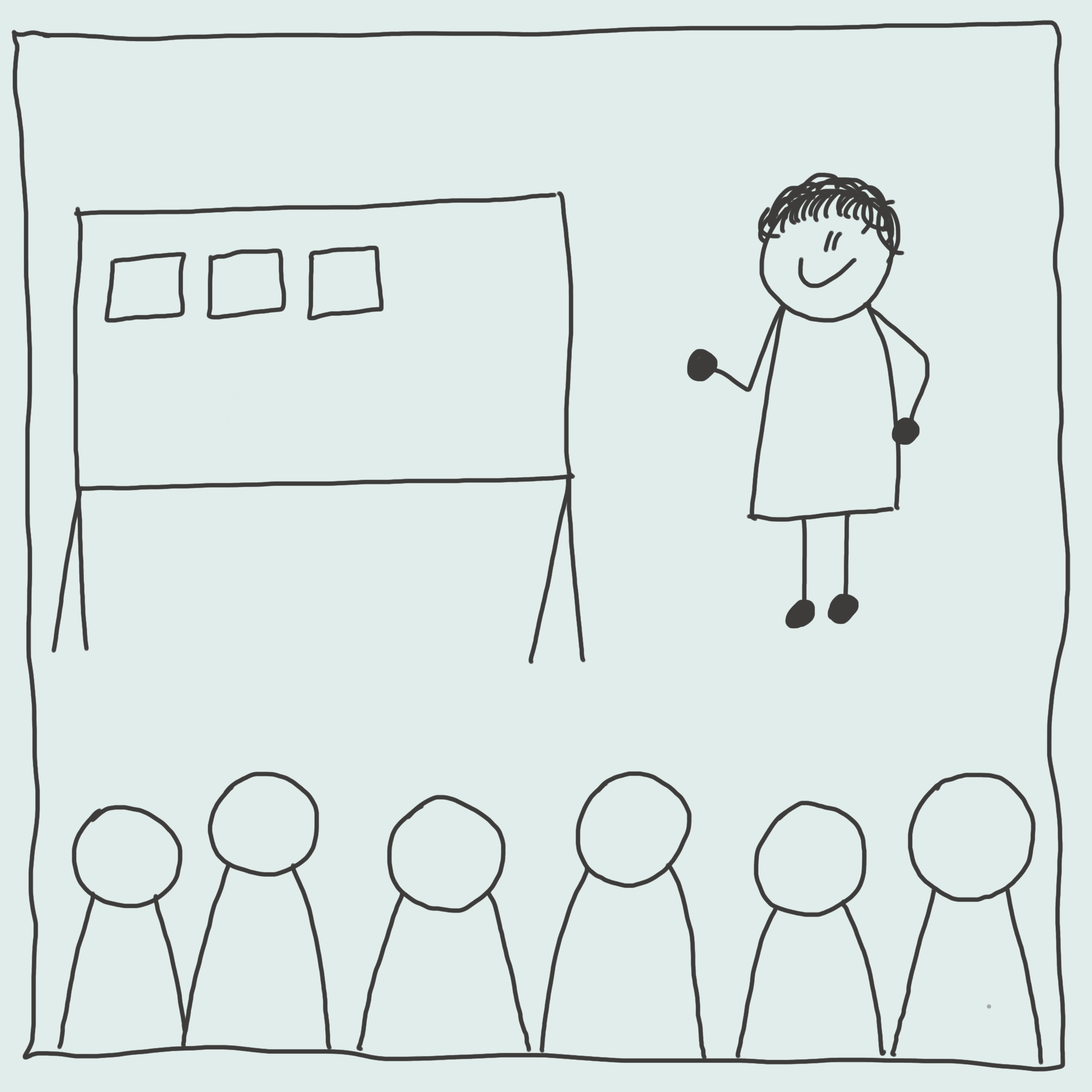




Eine Antwort
Super, endlich ist der Blogbeitrag da und ich habe deinen gleich bei meinem „Was ist der Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit?“ verlinkt.