Herausforderndes Verhalten begegnet pädagogischen Fachkräften in Kitas und Schulen täglich – sei es ein Kind, das plötzlich laut schreit, andere Kinder schlägt oder sich unter dem Tisch versteckt. In diesem Blogartikel erfährst du, was herausforderndes Verhalten ist, warum es individuell wahrgenommen wird und was es für einen professionellen Umgang braucht.
Definition: Herausforderndes Verhalten
Die fachliche Definition:
Laut Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff ist herausforderndes Verhalten von Kindern ein Verhalten, das für andere – zumeist für Erwachsene – eine besondere Herausforderung darstellt.
Auch der dänisch-schwedische Psychologe Bo Hejlskov Elvén definiert herausforderndes Verhalten als Verhalten, das den Menschen im Umfeld einer Person Probleme bereitet.
Diese Definition betont zwei zentrale Aspekte:
-
Die Auswirkung auf das Umfeld: Ein Verhalten gilt als herausfordernd, weil es von den Menschen in der Umgebung als problematisch erlebt wird.
-
Die Kontextabhängigkeit: Das Verhalten ist nicht von sich aus problematisch, sondern wird erst durch die Wahrnehmung und Reaktion des Umfelds als herausfordernd bewertet.
Ein Kind schreit? Für Kollegin A ist das völlig okay – sie bleibt gelassen. Für dich fühlt es sich kaum auszuhalten an. Ein anderes Kind isst nicht? Du bleibst ruhig. Deine Kollegin platzt fast vor Frustration und Hilflosigkeit.
Warum ist das so?
Weil herausforderndes Verhalten individuell ist. Was mich herausfordert, muss dich nicht herausfordern und umgekehrt.
Aber es ist noch komplexer:
Was in der Kita Sonnenblümchen als „problematisch“ gewertet wird, gilt in der Kita Regenbogen als völlig „normal“. Ein Kind, das viel Bewegung braucht, wird in engen Räumlichkeiten als „schwierig“ wahrgenommen – in einer Kita mit vielen Bewegungsangeboten fällt es gar nicht auf.
Damit verschiebt sich der Fokus vom Kind allein hin zur Wechselwirkung zwischen Kind, Fachkraft und Rahmenbedingungen.
Typische Verhaltensweisen bei herausforderndem Verhalten
In meinen Weiterbildungen und Prozessbegleitungen zu herausforderndem Verhalten werden vor allem folgende Verhaltensweisen genannt:
-
Laute Äußerungen wie Schreien, Weinen, Kreischen
-
Beißen, Hauen, Schubsen
-
Kratzen, Spucken, Dinge werfen
-
Schlagen, Treten, Boxen
-
Weglaufen oder sich verstecken
Und manchmal sind es gar nicht die extremen Situationen, auch die Frage „Wann kommt meine Mama?“ kann nach dem zehnten Mal als herausfordernd erlebt werden. Und wenn du allein mit 25 Kindern im Garten bist und das Mittagessen ruft, kann sogar das alltägliche Spiel der Kinder zur Herausforderung werden.
Wichtig ist dabei: Jedes Verhalten hat einen guten Grund. Kinder zeigen durch ihr Verhalten, was sie gerade brauchen – selbst wenn es für uns schwierig ist, das zu erkennen.
Unterschied „herausforderndes Verhalten“ und „Verhaltensauffälligkeit“
Synonyme oder verwandte Begriffe für herausforderndes Verhalten sind unter anderem „Problemverhalten“, „auffälliges Verhalten“, „störendes Verhalten“ oder „schwieriges Verhalten“. Auch der Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“ wird häufig genutzt.
Der Unterschied zwischen den Begriffen Herausforderndes Verhalten und Verhaltensauffälligkeit liegt vor allem in der Perspektive und Bewertung des Verhaltens.
Der Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“ wird häufig im diagnostischen Kontext verwendet und taucht auch in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsprobleme (ICD) auf. Er beschreibt ein Verhalten, das von einer Norm abweicht und häufig von anderen als störend empfunden wird. Nicht selten wird nicht nur das Verhalten, sondern das Kind selbst als „auffällig“ bezeichnet.
Der Begriff „herausforderndes Verhalten“ regt dazu an, den Fokus von der Person mit dem herausfordernden Verhalten auf die Interaktion mit dem Umfeld zu verschieben und nach Lösungsansätzen in der Gestaltung dieser Interaktion zu suchen.
Die Frage ist nicht:
„Was stimmt mit dem Kind nicht?“
sondern:
„Was fordert mich heraus und was kann ich tun?“
Diese Perspektive eröffnet Handlungsspielräume, fördert Reflexion und unterstützt professionelles Handeln, statt vorschnell zu bewerten oder gar zu pathologisieren.
Professioneller Umgang mit herausforderndem Verhalten
Bo Hejlskov Elvén betont, dass das Umfeld in Schwierigkeiten gerät, wenn keine geeigneten Methoden zum Umgang mit dem Verhalten zur Verfügung stehen. Er unterscheidet dabei zwischen:
-
Gefährlichem Verhalten, das eine sofortige Reaktion erfordert
-
Schwierigem Verhalten, das keine sofortige Reaktion erfordert, aber dennoch eine gezielte Strategie zum Umgang benötigt
Beides braucht zunächst vor allem eines: die Haltung, dass jedes Verhalten einen guten Grund und eine Botschaft hat. Kinder kommunizieren durch ihr Verhalten, besonders dann, wenn ihnen Worte fehlen. Ein Wutausbruch, Rückzug oder ständiges Nachfragen sind also keine Provokationen, sondern ein Versuch, ein Bedürfnis auszudrücken.
Diese Sichtweise erfordert daher einen reflektierten und systematischen Umgang mit herausforderndem Verhalten, der über spontane Reaktionen und Bewertungen hinausgeht. Der Weg beginnt mit gezielter Beobachtung, um Ursachen und konkrete Auslöser zu erkennen und bewusst zu unterscheiden.
Dabei ist fundiertes Fachwissen erforderlich, zum Beispiel zur emotionalen Entwicklung, zur Wahrnehmungsverarbeitung, zu den exekutiven Funktionen und zu möglichen traumatischen Belastungen. Diese differenzierte Analyse bildet die Basis, um die Funktion des Verhaltens und das dahinterliegende Bedürfnis zu klären.
Erst durch diese Klarheit lassen sich passende Lösungen auf verschiedenen Ebenen entwickeln. Zu berücksichtigen sind immer:
-
das Kind selbst mit seinen individuellen Ressourcen und Bedürfnissen
-
die pädagogische Fachkraft mit ihrem eigenen Erleben und ihrer Haltung
-
die Rahmenbedingungen, zum Beispiel Strukturen und Abläufe
Ein Beispiel:
Zurück zu dem Kind, das zehnmal am Tag fragt: „Wann kommt meine Mama?“
Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht anstrengend oder nervig, besonders, wenn du die Frage schon zigmal beantwortet hast. Doch was steckt dahinter?
Vielleicht fehlt dem Kind Orientierung. Es weiß nicht genau, wann Mama wiederkommt und braucht eine klare zeitliche Struktur oder Visualisierung, zum Beispiel durch einen Tagesplan mit Symbolen oder Bildern.
Es kann aber auch sein, dass das Kind Austausch sucht. Vielleicht hat es gelernt, dass auf diese Frage immer eine Reaktion folgt, ein kurzer Blickkontakt, ein Gespräch oder eine Zuwendung. Dann geht es weniger um die Antwort, sondern um die Beziehung.
Oder das Kind empfindet die Geräuschkulisse in der Gruppe als zu laut. Durch das wiederholte Fragen hört es seine eigene Stimme und übertönt damit die Geräusche, die es überfordern.
Drei mögliche Gründe, ein Verhalten und völlig unterschiedliche Funktionen und Bedürfnisse dahinter.
Erst wenn wir verstehen, warum ein Kind sich so verhält, können wir wirklich passend reagieren.
Und genau das ist der Kern eines professionellen Umgangs mit herausforderndem Verhalten: Nicht vorschnell zu bewerten, sondern neugierig zu bleiben, zu beobachten, Hypothesen zu bilden und (gemeinsam im Team) passende Wege zu finden.
Fazit
Herausforderndes Verhalten fordert uns – aber es lädt uns auch ein, genauer hinzuschauen. Wenn wir verstehen, was hinter einem Verhalten steckt, entsteht Raum für Verständnis, neue Perspektiven und passende Lösungen.
Ein professioneller Umgang mit herausforderndem Verhalten bedeutet, das Kind nicht isoliert zu betrachten, sondern das gesamte System mitzudenken: das Kind mit seinen Bedürfnissen, die Fachkraft mit ihrem Erleben und die Rahmenbedingungen, die Einfluss nehmen.
Es braucht fundiertes Fachwissen, Reflexion und vor allem eine Haltung, die davon ausgeht, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Erst aus dieser Haltung entsteht die Klarheit und Handlungssicherheit, die wir im Alltag brauchen, um Kinder wirklich wirksam zu begleiten – auch dann, wenn es herausfordernd wird.

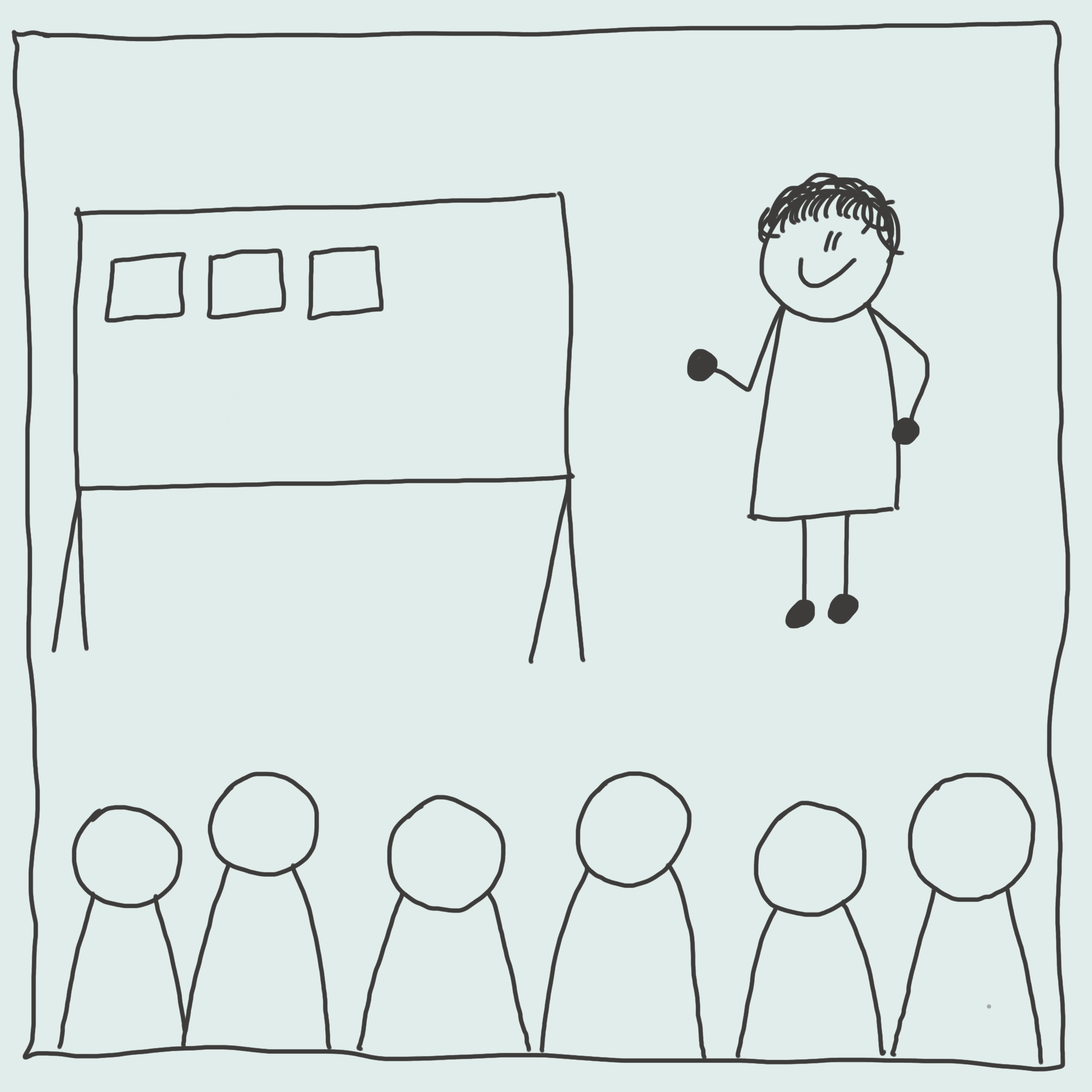




2 Antworten
Liebe Katja,
dein Artikel trifft einen so wichtigen Punkt: Herausforderndes Verhalten ist immer auch ein Signal – und deine klare Unterscheidung zwischen Verhalten und Person ist essenziell.
Besonders wertvoll finde ich deinen Hinweis, dass hinter jedem Verhalten ein ungelöstes Bedürfnis steckt. Das ist eine Haltung!
Danke für diese präzisen und hilfreichen Gedanken – sie bestärken mich darin, in meiner Praxis noch bewusster auf diese Signale zu achten.
Liebe Grüße,
Anja
Liebe Anja, vielen Dank für dein Feedback zu meinem Artikel und ja, du sagst es: es geht um unsere Haltung!
Ganz liebe Grüße aus Berlin, Katja